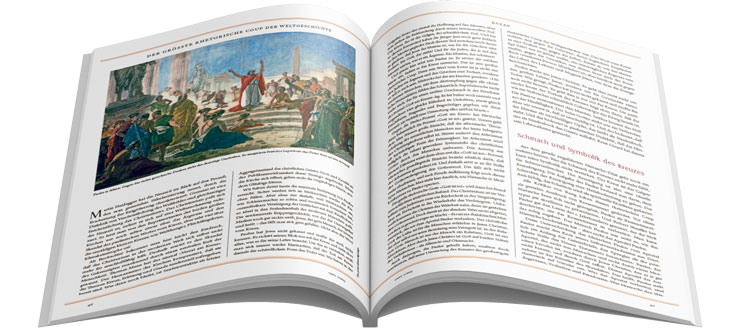Paulus hat Jesus nicht gekannt und mußte ihn auch nicht kennen. Er richtet seinen Blick nur auf das Kreuz und sieht dort alles, was er für seine Lehre braucht. Um das zu verstehen, muß man sich immer wieder klarmachen, daß der Tod am Kreuz damals die schändlichste Form des Todes war. Und genau hier setzt nun Paulus an. Er wertet die antiken Werte um, indem er das Kreuz umwertet

Martin Heidegger hat die Neuzeit im Blick auf den Prozeß, den man gemeinhin Säkularisierung nennt, durch die Erscheinung der Entgötterung charakterisiert. Gemeint ist eine Dialektik von Verchristlichung des Weltbildes und gleichzeitiger Entchristlichung des Christentums. Das Christentum paßt sich der Neuzeit an, indem es sich auf eine Weltanschauung reduziert. So hört man von den Repräsentanten der beiden großen Kirchen nur noch selten etwas über das Ärgernis und den Skandal des paulinischen Wortes vom Kreuz, aber sehr viel über die unzähligen kleinen Kreuze wie Welthunger, Flüchtlingskrise, Klimakatastrophe usf.
Als Beobachter bekommt man hier leicht den Eindruck, daß das Christentum in der modernen Welt sich selbst nicht mehr für anschlußfähig hält. Deshalb ersetzt es den Skandal des Gekreuzigten zunehmend durch einen neutralen Kult der Menschheit. Thomas Mann hat das einmal »Verrat am Kreuz« genannt. Der Humanismus der Kirchen kompensiert, daß sie die Themen Kreuz, Erlösung und Gnade tendenziell aufzugeben bereit sind. Was dann noch bleibt, ist Sentimentalität als letzter Aggregatzustand des christlichen Geistes. Doch sind Zweifel an der Publikumswirksamkeit dieser Strategie angebracht. Wenn die Kirche sich öffnet, gehen nicht die Ungläubigen hinein, sondern Gläubige hinaus.
Wir haben damit heute die maximale Entfernung von Paulus erreicht. Sicher werden sich an Weihnachten wieder die Kirchen füllen. Aber eben nur deshalb, weil Weihnachten als, wie Schleiermacher so schön und verräterisch formuliert hat, »unmittelbare Vereinigung des Göttlichen mit dem Kindlichen« so ideal in den Seelenhaushalt des modernen Menschen paßt. Die sentimentale Krippengeschichte, von der der Urevangelist Markus noch gar nichts weiß; Jesus, der gute Mensch, der tröstet und heilt – das läßt man sich gern gefallen. Nicht aber das Wort vom Kreuz.
Paulus hat Jesus nicht gekannt und mußte ihn auch nicht kennen. Er richtet seinen Blick nur auf das Kreuz und sieht dort alles, was er für seine Lehre braucht. Um das zu verstehen, muß man sich immer wieder klarmachen, daß der Tod am Kreuz damals die schändlichste Form des Todes war. Wir haben in der Golgatha-Szene also einmal die Hoffnung auf den Messias, aber zum andern die Enttäuschung durch seinen jammervollen Tod. Das Kreuz, das ist der Galgen, der schmählichste Tod. Und bis zu diesem Kreuzestod haben die Jünger Jesu noch ganz jüdisch an den Messias geglaubt. Nach diesem Tod trotzdem noch daran zu glauben, daß Jesus der Messias ist, war für die Griechen eine Torheit. Ein Gott, der stirbt! Und für die Juden, die ja auf den Messias warten, war es ein Ärgernis. Ein Messias, der scheitert!
Und genau hier setzt nun Paulus an. Er wertet die antiken Werte um, indem er das Kreuz umwertet. Das ist sein großer rhetorischer Coup. Denn sein Wort vom Kreuz ist ja nicht nur den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, sondern es soll es auch sein. Nietzsche hat das am klarsten gesehen: »Die modernen Menschen, mit ihrer Abstumpfung gegen alle christliche Nomenklatur, fühlen das Schauerlich-Superlativische nicht mehr nach, das für einen antiken Geschmack in der Paradoxie der Formel ›Gott am Kreuze‹ lag. Es hat bisher noch niemals und nirgendswo eine gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich Furchtbares, Fragendes und Fragwürdiges gegeben wie diese Formel: sie verhieß eine Umwertung aller antiken Werte.«
Gegen die Paulus-Formel »Gott am Kreuz« hat Nietzsche dann bekanntlich die Formel »Gott ist tot« gesetzt. Voraus geht dem Max Stirners große Einsicht, daß die atheistische Thronerhebung des neuzeitlichen Menschen nur das letzte Inkognito des Christenglaubens selbst ist. Stirner entlarvt den Atheismus als hartnäckigste Form der Frömmigkeit. Im Atheismus wird lediglich die vakant gewordene Systemstelle des christlichen Gottes durch den Menschen umbesetzt. Den Ausweg aus diesem Dilemma weist dann eben erst die »Gott ist tot«-Formel. Nietzsches grundlegende Einsicht besteht nämlich darin, daß der Atheismus gescheitert ist. Und deshalb setzt er an die Stelle der Gottesverleugnung den Gottesmord. Das läßt sich nicht mehr überbieten, und auch Freuds Aufklärung folgt noch dieser Spur Nietzsches. Man sieht hier deutlich, wie Nietzsche in Idealkonkurrenz zu Paulus operiert.
Die große rhetorische Geste »Gott ist tot« wird dann bei Freud zum schlichten analytischen Befund. Das Christentum ist im Verhältnis zum Judentum zwar ein Rückschritt in der Vergeistigung, aber ein Fortschritt in der Wiederkehr des Verdrängten. Unbewußt kommen die Christen der Wahrheit nahe, denn sie gestehen den Gottesmord. Doch damit ist der absolute Vater nicht abgetan, sondern er gewinnt sogar an Macht – das ist ein dialektisches Meisterstück, das wir dem Apostel Paulus verdanken. Der christliche Gott der Liebe ist für die Menschen erfahrbar in Jesus Christus, der aber selbst nur seine Beziehung zum Vatergott ist. In der Relation Gott–Mensch ist nur der Mensch ein Relatum; Gott ist ein Absolutum. Aber durch Jesus Christus ist Gott auf beiden Seiten des Verhältnisses – als Allmacht und Ohnmacht.
Auch diejenigen, die Paulus gehaßt haben, mußten doch anerkennen, daß seine Umwertung des Kreuzes der großartigste rhetorische Coup der Weltgeschichte war. Das Wort vom Kreuz richtete sich gegen die Griechen, deren logischem Empfinden es eine Torheit war; gegen die Juden, denen es, wie der ehemalige Zelot nur zu genau wußte, ein unerträgliches Ärgernis sein mußte; gegen die Gnostiker, von denen denn auch der Bannfluch »anathema Jesous« überliefert ist; aber letztlich auch gegen das Leben des Lehrers und Magiers Jesus, von dem die Evangelien berichten.
Paulus macht aus Jesus Christus. Es geht ihm nicht mehr um den großen Lehrer Jesus, sondern um die Geschichte seines Todes. Wie gesagt, Paulus hat Jesus nicht gekannt und mußte ihn auch nicht kennen. Es geht ihm ja nur um das Kreuz. Die paulinische Ironie der Torheit des Kreuzes liegt eben darin, daß der wie ein Verbrecher schmählich Gekreuzigte der König Israels ist. Die Passion entauratisiert den Messias. Seither kommt das Heil aus der Hinfälligkeit. Der Sohn Gottes stirbt wie ein Verbrecher. Aber wir wissen ja, daß er unschuldig ist. Und das bedeutet, daß der Messias als unschuldiges Opfer, das heißt als Sündenbock, stirbt. Und das bedeutet in paulinischer Dialektik, daß der Messias als Sündenbock das Gesetz aufhebt. René Girard hat daraus sein Lebensthema gemacht.
Schmach und Symbolik des Kreuzes
Aus dem gerade angeführten Nietzsche-Zitat geht noch ein weiteres hervor: Wer die Schmach des Kreuzes nicht mehr fühlt, kann seine Symbolik nicht verstehen. Das Kreuz ist der Galgen für Schwerverbrecher. Die Kreuzigung ist also eine rituelle Erniedrigung. Die Aufgabe des Paulus bestand nun darin, dem Schrecken der Kreuzigung eine Heilsbedeutung zu geben. Der Anti-Erfolg, das Scheitern wird als spirituelle Exzellenz gedeutet.
Alle Kritiker von Rang haben diesen rhetorischen Coup als genialen Ausdruck von Ressentiment gedeutet. Vor allem Nietzsche kann sich nicht genugtun, Paulus als Ressentimenttypus par excellence zu präsentieren. Und Robert Sheaffer hat Paulus gar den Lenin des 1. Jahrhunderts genannt, der die Welt durchreiste, um das Ressentiment zu verbreiten. Man kann das ruhig zugeben. Der Mensch Paulus war wohl so, wie ihn Nietzsche beschrieben hat – aber nicht der Apostel Paulus.
Diese Unterscheidung des Menschen Paulus vom Apostel Paulus macht den Kern seines Selbstverständnisses aus. Deutlich am Anfang des Galaterbriefs, den Spengler als die peinlichste Stelle des Neuen Testaments bezeichnete: Paulus, der Apostel, der nicht von Menschen und nicht durch einen Menschen berufen ist, sondern durch Jesus Christus, den er ja gar nicht kannte, und durch Gott selbst. Dieser Apostel der Ausnahme ist der Künstler des Skandalon. Das heißt, Paulus stellt rhetorisch auf Unruhe um. Was der Apostel verbreitet, sind Ärgernisse, Torheiten und Paradoxien. Was Nietzsche den Sklavenaufstand in der Moral nannte, zeigt bei näherer Betrachtung des Apostels Paulus ein ganz anderes Gesicht. Das Ressentiment wird kreativ und setzt neue Werte: Das Nichts vor Gott vernichtet den Stolz der Korrekten, die sich selbst rühmen. »Das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten« (1. Kor 1,28). Gegen das Establishment die Parias! Im 1. Korintherbrief 4,13 heißt es: »Wir sind sozusagen der Abschaum der Welt geworden, verstoßen von allen bis heute.« Daran wird einmal die Ästhetik des Häßlichen anschließen.
Die Predigt vom gekreuzigten Christus ist den Juden ein Ärgernis (Skandalon) und den Griechen, den Heiden, eine Torheit (Moria). Das Wort vom Kreuz ist ein Skandal. »Skandalon« heißt aber nicht nur »Ärgernis« sondern auch »Falle«. Gemeint ist der Fallstrick, der die Juden zu Fall bringt. »Moria« heißt »Torheit« und »Einfalt«. Aber die Weisheit der Griechen, für die das Wort vom Kreuz Torheit ist, ist ja für Paulus selbst Torheit vor Gott. Das macht auch die Moria zum Skandal. In dem Affekt von Celsus, der die Lehre von der Auferstehung empörend und unmöglich nennt, kommt das sehr gut zum Ausdruck. Ähnlich hat dann der Neuheide Goethe nur Abscheu empfunden vor dem »Jammerbild am Holze«.
Aber »Jammerbild« trifft durchaus zu. Das Kreuz steht für das Sein im Leiden. Und nicht nur wir sollen dieses Kreuz auf uns nehmen, sondern Gott selbst hat es getan. Auch das ist ein Skandal: Gott in Knechtsgestalt. Die leidende Allmacht teilt das Schicksal des Menschen. Das ist eine außerordentlich raffinierte Antwort auf die Theodizee-Frage. Das Problem des Leidens, aus dem seit Hiob die Argumente gegen Gott erwachsen, wird durch einen Gott, der selbst leidet, verdeckt. Am Kreuz leidet Gott selbst und weiß nicht warum. Wie Jacob Taubes so prägnant formuliert hat: »Das Martyrium selbst ist das Mysterium.«
Der Sohn Gottes war in der Passion ohne Vater. Die verzweifelte Frage am Kreuz lautet ja: Warum hast du mich verlassen? Diese Frage bleibt in der Passionsgeschichte ohne Antwort. Doch Paulus hat die Antwort gefunden. Gott verbirgt sich in der Weltgeschichte, die sich in der Passion Christi zuspitzt. Deshalb muß man die Einheit von Leiden und Gott erkennen. Christus ist ja ein Mann, der nicht das Schwert führt, sondern am Kreuz hängt. Er siegt, indem er unterliegt, er herrscht durch Kraftlosigkeit. Christus ist also die fleischgewordene Paradoxie. Die Passionsgeschichte hat dem Messias die Aura, den Glanz des Majestätischen genommen. Und seither kommt das Heil aus der Hinfälligkeit.
Das Ganze darf aber kein Scheingeschehen, sondern es muß härteste Wirklichkeit gewesen sein. Das Kreuz trennt nämlich den Glauben von der Gnosis. Es geht um die Möglichkeit einer Möglichkeit, die nicht von der Wirklichkeit bedingt ist – aber doch bezeugt ist durch ein einmaliges historisches Ereignis, das den Durchgang durch die radikale Negation vollzieht, nämlich Kreuzestod und Auferstehung. Das Wort vom Kreuz stellt uns also vor ein radikales Entweder-Oder: entweder Gottesweisheit oder Torheit. Es gibt nur noch Gerettete und Verlorene.
Mit Christus beginnt die Geschichte neu. Es gibt nun ein »ante« und ein »post«. Was »ante« war, können wir kompakt behandeln – nämlich als Erbsünde. Wie in der Psychoanalyse der Ödipuskomplex, so ist in der Theologie die Erbsünde von Anfang an da. Erbsünde besagt also: Ich werde nicht zum Sünder, sondern bin es immer schon. Der Sünder ist schlicht der empirische Mensch. Der erste und schwerste Schritt auf dem Weg, an Gott zu glauben, besteht deshalb darin zu glauben, ein Sünder zu sein.
Die Erbsünde ist die Bedingung der Möglichkeit von Selbsterkenntnis, denn diese interpretiert die Selbstbehauptung als Verstocktheit gegen den Anspruch Gottes. Für diesen empirischen Menschen, der das Ziel der Selbsterhaltung hat und dabei auf sich selbst vertraut, hat Paulus das Wort »Sarx«. »Fleisch« ist zwar die wörtlich korrekte Übersetzung, aber gemeint ist der sterbliche Mensch als ganzer, das Sündhafte. Aus dem Gefängnis des Sarkischen befreit nur das »Pneuma«, übersetzbar mit »Hauch« oder »Atem«, »Seele« oder »Leben« – neutestamentlich »Heiliger Geist«. Bei Paulus ist der Mensch also Diener zweier Herren: Sarx und Pneuma.
Du sollst nicht begehren
Für das Verständnis entscheidend wichtig ist hier eine Stelle aus dem Römerbrief des Paulus, nämlich 7,13. Die Funktion der Gesetze und Gebote ist es, die Sünde als Sünde sichtbar zu machen. Wie es in der Einheitsübersetzung heißt: Durch das Gebot soll sich die Sünde in ihrem ganzen Ausmaß als Sünde erweisen. Paulus hat die jüdische Tradition auf ein Verbot reduziert: Du sollst nicht begehren. Dieses Gesetz ist nicht erfüllbar. Aber die Unerfüllbarkeit des Gesetzes macht es nicht sinnlos. Im Gegenteil, gerade weil das Gesetz unerfüllbar ist, macht es den Menschen grundsätzlich als Sünder erkennbar. Das Gesetz ist dazu da, dem Menschen zu zeigen, daß er ein Sünder ist. Man könnte auch sagen, das Gesetz holt die Sünde aus ihrem Latenzzustand heraus und konkretisiert sie zum Begehren. Und Paulus macht dann aus der Not der Unerfüllbarkeit des Gesetzes die theologische Tugend der Rechtfertigung durch den Glauben. Das eigentlich unerfüllbare Gesetz klagt uns an. Es stürzt uns in eine ausweglose Rechtfertigungsbedürftigkeit. Und daraus befreit uns der Glaube an den gnädigen Gott.
Man kann das als ein Stück theologischer Anthropologie lesen: Das Gesetz wird von Paulus zum Verblendungszusammenhang anthropologisiert, aus dem nur das Christusgeschehen befreit. Man kann es aber auch wie Nietzsche sehen: Der großartige § 68 der Morgenröte hat die Überschrift »Der erste Christ«. Das ist natürlich Paulus, der als Saulus der fanatische Verteidiger und Wächter des strengen Gesetzes-Gottes war, um doch immer wieder zu erleben, daß sich das Gesetz nicht erfüllen läßt und ständig zur Übertretung verführt. »Das Gesetz war das Kreuz, an welches er sich geschlagen fühlte.«
Paulus hat das Problem des Pharisäers durchschaut: die Tragödie der Gesetzestreue. Man kann nicht aus guter Gesinnung das Gesetz erfüllen, solange man Angst haben muß, für seine Übertretung bestraft zu werden. Das Problem läßt sich nicht durch Eifer lösen, sondern nur durch einen Freispruch von außen. Aber daraus folgt etwas ganz Entscheidendes: Nicht die Übertretung des Gesetzes, sondern der Gesetzeseifer ist der Fehler – nämlich die Absicht, durch die Erfüllung des Gesetzes gerecht vor Gott zu werden. Alles, was Paulus sagt, warnt vor dem Abgrund der Selbstgerechtigkeit. Der Mensch wird nicht Sünder, sondern er ist es – auch wenn er das Gebot erfüllt. Wenn man das begreift, versteht man auch, was mit dem so unantiken Wort »Sünde« eigentlich gemeint ist. Die Sünde ist das Verhältnis des Menschen zu Gott.
Auch hier ist die Parallele zum Ödipuskomplex schlagend. Das Fundamentale ist die Schuld. Oder wie Jacob Taubes es formuliert hat: »Schuld ist konstitutiv für den Menschen«. Das bedeutet aber, daß die Menschwerdung des Menschen durch das Schuldbewußtsein führen muß. Und deshalb setzt Paulus den Hebel am Schuldbewußtsein an. Niemand hat das besser verstanden als Freud, als er die historische Wahrheit des Christentums im Bekenntnis zum Gottesmord fand. Paulus hat dieses Schuldbewußtsein beschworen und die Lösung des Problems gefunden, nämlich die Erlösungsphantasie.
Die Erlösung liegt darin, daß das Entscheidende bereits geschehen ist. Das Gericht steht zwar noch bevor, aber die, die glauben, haben den Freispruch sicher. Nun ist dieser Glaube, der rechtfertigt, psychologisch betrachtet eigentlich unmöglich. Deshalb muß sich die Rechtfertigung als ein Identitätswechsel vollziehen. Und genau dafür steht ja die Taufe: Sie bringt das Heil durch Identitätswechsel. Mehr Anti-Natur geht nicht. Nur als Diener des Pneuma kann ich mich der Herrschaft des Sarx entziehen. Nietzsche trifft deshalb wieder den entscheidenden Punkt, wenn er die Umwertung der Werte durch den Juden Paulus als eine »Entnatürlichung der Natur-Werte« bezeichnet.
Um zu dieser Umwertung der Werte in der Lage zu sein, bedarf es in der Tat eines Damaskuserlebnisses, einer Bekehrung. Im 2. Korintherbrief 12,2 heißt es: »Ich kenne jemanden, einen Diener Christi, der vor vierzehn Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde; ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah […]«. Es geht um eine Sinnesänderung von extremer Radikalität, die man nicht durch Nachdenken erreichen kann, sondern die von außen kommen muß. Das ist die Metanoia der Buße. Gegen das stolze griechische Denken steht das demütige Umdenken.
Welche Folgen hat das für das Verhältnis des Christen zur Welt? Der Christ, der nicht die Virtuosenleistungen der Askese erbringen kann, nimmt die akosmische Haltung des Als‑ob‑nicht ein. Das heißt auf deutsch: die Welt nicht ernst nehmen. Im 1. Korintherbrief 7,29 ff. heißt es: »Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine; und die weinen, als weinten sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht; und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht.«
Doch was soll das heißen: die Welt gebrauchen, als ob wir sie nicht brauchten? Wie Christus sich nicht um Politik und Wirtschaft kümmert, so hat auch der Christ als Christ keine Beziehung zum öffentlichen Leben, obwohl er als Staatsbürger natürlich sehr wohl auf die Gesetze dieser Welt verpflichtet bleibt. Christus und das Evangelium kümmern sich nicht um die Angelegenheiten dieser Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! Vor das ganze äußerliche, zeitliche Leben setzt der Christ ein Vorzeichen: das Kreuz. Und das Kreuz ist eben nicht sozialisierbar.
Das Wesen dieser Welt vergeht
Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, denn es ist nicht der Rede wert. Dieses Paulus-Motiv hat Jacob Taubes sehr prägnant herausgearbeitet. Er geht dabei von der gerade erwähnten Stelle des 1. Korintherbriefs aus: Die Zeit ist kurz und das Wesen dieser Welt vergeht. Verhaltet euch zu allem Weltlichen, als ob es nicht wäre, und seid ohne Sorge. Was Taubes hier unterstreicht, ist, daß nichts in der Welt wirklich wichtig ist. Die Welt wird damit aber nicht entleert, sondern nur entwertet. Paulus ruft die Gläubigen gerade nicht zur Weltverantwortung, sondern zur »Weltlockerung«. Wir sollen als Gläubige nicht die sozialen und politischen Probleme der Welt lösen, sondern unser Verhältnis zu ihr lockern.
Das ist eine ganz entscheidende Dimension der Freiheit eines Christenmenschen. Die christliche Freiheit des Als‑ob‑nicht schafft Distanz, Weltlockerung und Gelassenheit. Der Begriff »Gelassenheit« hat dann in der Philosophie Martin Heideggers Karriere gemacht. Und obwohl Heidegger sich immer wieder dagegen verwahrt hat, als christlicher Philosoph verstanden zu werden, leitet sich sein Begriff der Gelassenheit eindeutig vom paulinischen Als‑ob‑nicht ab. Gemeint ist die »Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein« zur Welt. Wir nehmen die Dinge der Welt so in Gebrauch, wie sie genommen werden müssen, aber doch so, daß wir sie jederzeit loslassen können. Mit anderen Worten, wir behandeln die Dinge dieser Welt »als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht«.
Der neben Karl Barth bedeutendste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, hat nicht nur bei Heidegger studiert, sondern auch seine gesamte Theologie auf der Grundlage von Heideggers Denken entwickelt. Und dabei spielt die Deutung des Als‑ob-nicht als Gelassenheit eine Schlüsselrolle. Man könnte auch mit Kierkegaard von Humor oder mit Taubes von Weltlockerung sprechen. Entscheidend ist, daß sich der Christ der weltlichen Einrichtungen nur »in der Distanz des ›als ob nicht‹« bedient. Das gilt ebenso für diejenigen weltlichen Einrichtungen, die man Wissenschaften nennt. Und so fordert Bultmann die Christen auf, sich nicht gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft zu verschließen. Aber wir sollen eben auch die moderne Wissenschaft haben, als ob nicht!
Die christliche Existenz lebt also in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie gehört dieser Welt nicht. Sein im Als‑ob‑nicht: so definiert Bultmann die eschatologische Existenz. Ich lebe entweltlicht in der Welt. Indem ich glaube, gehöre ich schon in dieser der kommenden Welt an. Denn der Urteilsspruch Gottes, der mich rechtfertigt, steht nicht mehr aus, sondern ist schon gesprochen. Weil die Zeit kurz ist, bis die bestehende Welt vergeht, lohnt es sich nicht mehr, sich um irdische Angelegenheiten zu sorgen. Deshalb tu das, was du tust, als ob du es nicht tun würdest. Du bist verheiratet, aber lebe so, als ob du es nicht wärst. Du hast Geld, aber tu so, als ob du es nicht hättest. Sei ohne Sorge. Der Mensch soll zwar arbeiten und seinen Beruf ernst nehmen, aber er soll sich nicht sorgen.
Doch statt auf Gott zu vertrauen und sich auf sein Wort zu verlassen, neigen wir dazu, an die Stelle des Glaubens die Sorge zu setzen. Was uns dann fehlt, ist die Gelassenheit, die unser Verhältnis zur Welt lockert. Wir müssen die irdischen Dinge schon ernst nehmen, aber so ernst nun auch wieder nicht. Das Als‑ob‑nicht des Paulus nimmt also gewissermaßen das Ende der Welt vorweg. Die bestehende Wirklichkeit ist für den Christen durch das zugesagte Heil bereits »verunwirklicht«.
Wenn das Heil dann endlich kommt, verschwindet die Welt der Stückwerke. »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe« (1 Kor 13,13). Paulus’ große Leistung, die Umwertung der antiken Werte, steckt auch im Agape-Begriff wie in einer Nußschale. Wieder geht es um eine geistige Unmöglichkeit. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder als dich selbst. Wie soll das möglich sein? Der Nächste ist doch zuerst einmal mein Rivale! Die Lösung des Paulus ist genial: Ich liebe meinen Nächsten, den Fremden, nur »als Mandatar des unbekannten Gottes«. Und wie Karl Barth in aller Nüchternheit betont: »Eine direkte allgemeine ›Nächsten-‹ und Bruder- oder auch Fernsten- und Negerliebe ist nicht gemeint.« Die Nächstenliebe liebt im zufälligen Mitmenschen den fremden Gott. Und wenn Sigmund Freud gegen die christliche Liebesforderung darauf hinweist, daß nicht alle Menschen liebenswert sind, so besteht die Pointe des Begriffs »Agape« genau darin: den zu lieben, der nicht liebenswert ist; Leute zu lieben, die man nicht mag. Der Einwand, nicht jeder sei liebenswert, ist natürlich richtig. Aber die christliche Liebe schafft erst den Liebenswürdigen. Der Christ liebt den Bruder gerade auch dann, wenn dieser nicht liebenswert ist.
Mein Nächster als Mandatar des unbekannten Gottes – das ist eine äußerst bedeutsame Formel von Karl Barth. Mein Nächster ist gewissermaßen der Altar, an dem ich dem unbekannten Gott opfere. Und damit sind wir mit Paulus in Athen. Auch an der Apostelgeschichte kann man den rhetorischen Coup des Paulus verdeutlichen, obwohl man einräumen muß, daß die klassischen Philologen die Authentizität dieses Dokuments längst in Frage gestellt haben. Am schärfsten natürlich wie immer Wilamowitz, der in einer Rezension bemerkt: »Wer die Originalität jener Briefe [des Paulus] und die geschlossene Eigenart der Person, die hinter ihnen erscheint, verkennen kann, oder wer andererseits dessen Person die Areopagrede der Acta zutrauen kann, mit dem ist nicht zu reden.« Nun, wenn sie denn erfunden ist, ist sie gut erfunden.
Der Apostel der Ausnahme
Paulus macht aus einem unbekannten Gott, dem die Athener einen Altar gewidmet haben, den unbekannten Gott, der nun aber allen anderen Göttern die Existenz bestreitet. Mit anderen Worten, Paulus macht aus einem unbekannten Gott des Polytheismus den einzigen Gott. Das heißt, er suggeriert, die Griechen hätten den Monotheismus geahnt. Aber wahrscheinlich handelt es sich um eine noch viel radikalere Umdeutung. Glaubt man Hieronymus, dann stand auf dem Altar in Athen nicht, wie Paulus behauptet, »dem unbekannten Gott«, sondern »den Göttern Asiens, Europas und Afrikas, den unbekannten und wandernden Göttern«. In jedem Fall macht Paulus aus dem Plural einen Singular, das heißt aus dem Polytheismus der Griechen einen latenten Monotheismus.
Das konnte in Athen natürlich nicht funktionieren, und so ist seine Mission denn auch gescheitert. Aber dieses Scheitern hat der Sendung des Paulus keinen Abbruch getan. Was zählt schon die Wirklichkeit, wenn man die Wahrheit verkündet? Erik Peterson sagt einmal sehr schön: »die Blindheit von Damaskus hat nicht nur drei Tage bei Paulus angehalten, sondern sein ganzes Leben«. Weder die Wirklichkeit irritiert ihn noch die Tradition, weder die Urgemeinde noch das Leben dessen, den er als kerygmatischen Christus verkündet. Und das ist von allen Skandalen des Paulus wohl der größte. Er stilisiert sich zum Apostel der Ausnahme gegen die Zwölf. Und der Ausdruck, den er dafür findet, ist spektakulär: Er will vom Leben Jesu nichts wissen. Damit erklärt er die persönliche Beziehung der Urapostel zu Jesus als irrelevant.
Paulus verzichtet auf das Leben Jesu, um die ganze frohe Botschaft aus seinem Tod zu entwickeln. Paulus war ja der Apostel, der Jesus gar nicht kannte. Er interessierte sich aber auch gar nicht für das Leben Jesu, sondern konzentrierte den christlichen Glauben ganz und gar auf das Kreuzesgeschehen, nämlich auf die schmähliche Hinrichtung und die wunderbare Auferstehung des Gottessohns. Was soll Moses uns noch zu sagen haben, nachdem uns Christus erlöst hat?
In seinen Briefen macht Paulus aus Jesus Christus. Es geht ihm nämlich nicht mehr um den großen Lehrer Jesus, sondern nur noch um die Geschichte seines Todes. Alles, was man über Christus im Fleisch weiß (2. Kor 5,16), kann man getrost vergessen. Rudolf Bultmann hat diese Einstellung dann in aller Radikalität formuliert: »wie es in Jesu Herzen ausgesehen hat, weiß ich nicht und will ich nicht wissen«. Markion, der radikalste und konsequenteste Schüler des Apostels Paulus, hat deshalb das Alte Testament völlig verworfen.
Man übertreibt also nicht, wenn man Paulus die Überzeugung unterstellt, daß Jesus selbst sich nicht für das Leben Jesu interessiert hat. Er wollte nur das Wort Gottes sein. In Jesus ist das Wort Gottes ausgesprochen, und es ist völlig egal, ob er selbst wußte, daß er der Messias ist. Deshalb kann man den Inhalt seiner Verkündigung sogar ignorieren. Und genau das hat Paulus getan. Was man aber nicht ignorieren kann, ist »die Botschaft seines Gesendetseins«, das »Daß des Gesprochenwerdens«.
Jetzt können wir erst richtig ermessen, was den Griechen als Torheit erscheinen mußte. Pistis, das hat Eric Robertson Dodds sehr gut herausgearbeitet, war für die Griechen die primitivste Erkenntnisform, der Geisteszustand der Ungebildeten, die dem Hörensagen und unbewiesenen Behauptungen glauben. Indem er gerade darauf setzt, erreicht Paulus nun zweierlei. Zum einen formuliert er – um noch einmal seinen Intimfeind und Imitator Nietzsche zu zitieren – »das Veto gegen die Wissenschaft«. Und zum anderen sendet er die erste universale Botschaft. An die Stelle der Auserwähltheit des jüdischen setzt er den Universalismus eines neuen Volkes.
Um solche rhetorischen Coups, die die Welt aus den Angeln heben, zu landen, muß man einen archimedischen Punkt erreicht haben. Und genau das ist das Selbstverständnis des Apostels Paulus. Er weiß sich als ausgesondert und ausgesendet. Er ist der Apostel nicht von Menschen und nicht durch einen Menschen, und was er verkündet, ist nicht von menschlicher Art. Die Botschaft des Paulus hat also nichts mit Tradition zu tun.
Dieses Selbstbewußtsein definiert den Pneumatiker. Er ist der Übermensch, der Mensch in Christus. Das eigentliche Ich des Pneumatikers steht über dem Schicksal und über dem Gesetz. Der Pneumatiker kann alles beurteilen, aber von niemandem beurteilt werden. So 1. Kor 2,15. Pneuma ist Geist, aber heiliger Geist, und er hat ganz und gar nichts mit der menschlichen Weisheit zu tun. Für den Stoiker ist nur der Weise fromm. Aber diese Weisheit der Welt wird ja gerade vernichtet.
Nun müssen wir uns fragen: Macht Paulus, indem er sich als Pneumatiker weiß, nicht gerade den tödlichen Fehler, vor dem er sonst immer warnt, nämlich sich zu rühmen? Gerühmt werden muß. So beginnt das 12. Kapitel des 2. Korintherbriefs. Aber was gerühmt wird, ist der neue Mensch in Christus, nicht der Jude aus Tarsus. So führt Paulus ein Doppelleben als schwacher Mensch und als selbstgewisser Pneumatiker: stolz und zerknirscht zugleich. Richard Reitzenstein hat die Dialektik dieses Doppellebens erkannt: »Verherrlicht ist nur jenes göttliche Wesen in ihm, das stärker wird, je schwächer er selbst wird.« Und wir können verallgemeinern: Gerade die Schwäche des Menschen ist seine Stärke, denn sie verweist ihn auf seine Abhängigkeit von Gott.
Angesichts dessen könnte ein Bild verwirren, das Erik Peterson vom Apostel der Ausnahme entworfen hat: Paulus als Gladiator in der Arena. Er stützt sich dabei auf den 1. Korintherbrief 4,9, wo Paulus schreibt, die Apostel seien als Todgeweihte zum Schauspiel der Welt geworden. »Theatron« heißt zwar eigentlich »Theater«, aber Peterson deutet es als Arena der Gladiatoren, weil dort ja zum Tode Verurteilte auftreten. Der Apostel Paulus macht also nicht nur Skandal sondern auch Spektakel. Er spielt die Rolle des Unglücklichen, und alle Augen sind auf ihn gerichtet.
Es geht um den großen Auftritt, sei es auf der griechischen Agora, sei es in der römischen Arena. Hier schlagen die Demutsformeln des Nichts, des Abschaums, der Narren in Christus in einer extremen dialektischen Wendung um in Agitation und Propaganda. Wenn überhaupt von einer politischen Theologie des Paulus die Rede sein kann, dann hat sie hier ihren Ansatzpunkt. Wie Moses, Kyros und Theseus stiftet auch Paulus ein Volk durch Propaganda. Wohlgemerkt, nicht Jesus, sondern Paulus stiftet das Christentum. Nur deshalb kann man von politischer Theologie sprechen. Paulus begründet ein neues Volk. Denn das Volk Gottes ist nicht mehr das Volk Gottes. Im Römerbrief 9,25 steht dafür das Hosea-Zitat »Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war«.
Niemand hat die Parallele zwischen Moses und Paulus, die sich hier zeigt, besser verstanden als Freud. Er spricht von der »weltgeschichtlichen Entscheidung« des Ägypters Moses, der einige semitische Stämme auswählte, die »sein neues Volk sein sollten«. Genau so wählt der Jude Paulus dann Heiden aus, um sein neues Volk zu gründen. Wie die Juden für Moses »ein besserer Ersatz« für die Ägypter waren, so waren die Heiden für Paulus ein besserer Ersatz für die Juden. Freud resümiert: »Es war der eine Mann Moses, der die Juden geschaffen hat.« Und wir können resümieren: Es war der eine Mann Paulus, der die Christen geschaffen hat. ◆

NORBERT BOLZ,
geb. 1953 in Ludwigshafen, lehrte Medienwissenschaften an der TU Berlin. 2021 erschien bei Matthes & Seitz sein Buch Keine Macht der Moral!. Der einstige Assistent von Jacob Taubes twittert als @NorbertBolz.