Bundespräsident Steinmeier hat ein Buch geschrieben. Es heißt Wir. Hier wird hinter einem pseudokonservativen Jargon nur schlecht verborgen, daß das Staatsoberhaupt von den Deutschen als angestammtem Volk und dem Vaterland nichts wissen will, sondern einen »Patriotismus« fordert, der nur ein anderes Wort für Linientreue ist.
Foto: imago stock&people
Mit »Wir für Frank« wurde auf dem Außerordentlichen Bundesparteitag der SPD am 14. Juni 2009 für Steinmeiers Kanzlerkandidatur geworben. Der Bundespräsident Steinmeier ist dem »Wir« treu geblieben.
Der Bundespräsident hat ein Buch geschrieben. Es heißt Wir. Was sich bisher in Frank-Walter Steinmeiers Reden und sonstigen Einlassungen nur angedeutet fand, erhält hier Züge einer Doktrin samt Lehre vom Menschen, Lehre von der Geschichte und Lehre vom Gemeinwesen.
Für die Anthropologie nimmt Steinmeier wohl auf den Primatenforscher Michael Tomasello Bezug, der den Menschen als »das Tier, das ›wir‹ sagt« definiert hat. Der Name Tomasellos kommt aber schon deshalb nicht vor, um dem Vorwurf des Biologismus zu entgehen. An der Sache ändert das allerdings nichts, denn Steinmeier setzt Tomasellos Annahme »geteilter Intentionalität« voraus, die es unserer Spezies erlaubt, hochkomplexe soziale Verbände zu schaffen, die handeln, als ob sie eine Ganzheit wären. Dabei spielt Abgrenzung eine wichtige Rolle, was bei Steinmeier ebenfalls übergangen wird, obgleich sich im ganzen Text raunende Warnungen finden: vor der »Demokratieverachtung« und den »Rechtspopulisten mit kalter Siegermiene«, die es zu bekämpfen gilt, gerade weil sie ihre wahre Gesinnung »im bürgerlichen Gewand« verbergen.
Mit Sorge erfüllt Steinmeier diese Tendenz schon deshalb, weil sie »Geschichtsrevisionismus« treibt. Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt offen, aber es geht wohl um alles, was nicht die Art von Vergangenheitsbetrachtung stützt, die er für unverzichtbar hält. Deren Ausgangspunkt ist die Nachkriegszeit: »Wir bekennen uns zum Grundgesetz.« Was davor lag, scheint unerheblich oder gibt die dunkle Folie ab, von der sich die Erfolgsstory der »liberalen Demokratie« lichtvoll abhebt. Ihr Lebensgesetz ist das »Nie wieder!«.
Mit dem Bekenntnis »Wir bezeugen Auschwitz« erhält der »Gründungsmythos« (Joseph »Joschka« Fischer) der Bundesrepublik durch Steinmeier kanonische Geltung. Entsprechend gestaltet er sein »Narrativ«, und entsprechend sind die Lücken. Der Hörer erfährt deshalb nichts von den Ursachen für den Aufstieg Hitlers oder die Zustimmungsbereitschaft der Deutschen. Nirgends blitzt ein Funke Verständnis für das eigene Volk auf, aber unerbittlich sind die Verdammungsurteile. So heißt es etwa, daß das »Schicksal der Heimatvertriebenen aus dem Osten […] zu den katastrophalsten Folgen des Nationalsozialismus für die Deutschen« gehörte. Kurz und knapp: Im Grunde sind sie selbst verantwortlich für den Verlust der Siedlungsgebiete jenseits von Oder und Neiße, für Massenmorde und ‑vergewaltigungen, ethnische Säuberung und Enteignung. Kein Hinweis auf die machtpolitischen Ziele, die nicht nur die Alliierten verfolgten, sondern auch die Vertreiberstaaten, in erster Linie Polen und die Tschechoslowakei. Für die Zahl der Vertreibungsopfer setzt Steinmeier bezeichnenderweise die niedrigste denkbare Zahl an – 600 000 Tote und Vermißte –, während er für die gefallenen Sowjetsoldaten mit der höchsten – den zuletzt von Putin ins Spiel gebrachten 25 Millionen – argumentiert. Auch die werden ohne Zögern auf das deutsche Schuldkonto gebucht.
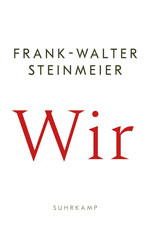
Frank-Walter Steinmeier: Wir,
Berlin (Suhrkamp) 2024,
Festeinband mit Schutzumschlag,
141 Seiten, 14 Euro
Das alles kann man weder auf Ahnungslosigkeit noch auf Zufall noch auf Versehen zurückführen. Hier geht es um ideologisches Kalkül, das darauf fixiert ist, »das historische Erbe unseres Landes mit seiner Tätergeschichte« gleichzusetzen. Die wurde erst beendet durch die alliierte »Befreiung« im Jahr 1945. Eine Wohltat, die die Deutschen nicht so dankbar angenommen haben, wie es wünschenswert gewesen wäre. Denn den »alten Eliten« gelang es, in »Leitungsfunktionen« zurückzukehren. Verglichen mit dieser braunen Belastung der Bundesrepublik erscheinen die Anfänge der DDR für Steinmeier in erstaunlich mildem Licht, da »die Gründung eines ›antifaschistischen‹ deutschen Staates durchaus von Hoffnungen begleitet war«.
Eher bedauernd gibt Steinmeier zu, daß irgendwann die demokratische Fassade bröckelte und es bis zur Friedlichen Revolution von 1989 dauerte, damit endlich alles gut werden konnte. Ein Happy-End war die Vereinigung der DDR mit dem Bonner Staat auch deshalb, weil dieser nach ’68 eine »gesellschaftliche Liberalisierung« erlebt und so ans Ziel der Geschichte gekommen war: »unserem Wir – einer freiheitlichen Republik mit gleichen Rechten«.
Daß diese nach und nach zu einer »pluralen Republik« wurde und ihren deutschen Charakter einbüßte, betrachtet Steinmeier nicht als Nach-, sondern als Vorteil. Denn erst wenn man »sich von Andersartigkeit nicht befremden und beängstigen« lasse, werde der notwendige Grad an Weltoffenheit erreicht. Dann hat es auch keinen Sinn mehr, vom Migrationshintergrund dieser oder jener zu sprechen, weil wir längst ein »Land mit Migrationshintergrund« sind, in dem sich alle auf Augenhöhe begegnen und in jener »Solidarität« wechselseitigen Gebens und Nehmens üben, die aus dem Mensch-Sein zwanglos folgt.
Oder doch nicht ganz zwanglos. Denn Steinmeier betont die Notwendigkeit »starker Institutionen«. Die dienen jedoch nur nebenher dem Zweck, die erwartbaren Krisen »in einer Gesellschaft der vielen Identitäten« zu bewältigen. Das heißt, »unser Land« wird seiner Meinung nach weder vom demographischen Kollaps noch von eingeschleppten Konflikten oder dem Islamismus bedroht (Steinmeier spricht sehr wohlwollend vom »muslimischen Deutschsein«). Es findet sich auch kein Hinweis auf den Zusammenbruch der Inneren Sicherheit, die desolate Situation der Infrastruktur oder die Bildungskatastrophe von den Grundschulen bis zu den Universitäten. Vielmehr sollen die »starken Institutionen« den entscheidenden politischen Akt vollziehen, das heißt den Feind bestimmen, denn »in einem Moment, in dem offener als zuvor begreiflich geworden ist, wie die Feinde unserer Verfassung die Menschenwürde attackieren, stehen nicht die Trennlinien im Mittelpunkt, sondern das Bekenntnis der Mehrheit zu unserem Wir«. Diese – selbstverständlich »demokratische« – Mehrheit rechtfertigt es auch, die Scheidung zwischen Gesellschaft und Staat aufzuheben, um ein »Gemeinwesen« neuen Typs zu schaffen, dessen Träger den »Staat nicht als etwas der Gesellschaft Fremdes oder gar Feindliches, sondern als Ausdruck des gemeinsamen Bemühens aller« betrachten. Das ist das Ziel, das Steinmeier durch eine »Staatsreform« erreichen will, die mit dem Übergang ins »postfossile Zeitalter« eingeleitet wurde.
Steinmeiers Kritiker setzen in der Regel an diesem Punkt an und werfen ihm das Festhalten an einer romantischen Gemeinschaftsidee vor. Aber dieser Einwand greift zu kurz. Denn er geht von einer genuin liberalen Position aus, die den Nachteil hat, quer zur politischen Wirklichkeit zu stehen. Wer darauf beharrt, daß es nur einzelne gibt, die irgendwie zu Trägern politischer und bürgerlicher Rechte geworden sind, sieht sich tagtäglich seines Irrtums überführt. Verglichen damit verfügt Steinmeier über ein höheres Maß an Wirklichkeitssinn. Er hat durchaus begriffen, daß »liberal« nur noch eine Chiffre ist, während um die Bedeutung des Wortes »demokratisch« ein heftiger Kampf entbrennen muß, weil sich eben nicht von selbst ergibt, wer der Demos – das Volk – ist, also wer »wir« eigentlich sind.
Auf diesen Sachverhalt hat ein klügerer Sozialdemokrat als Steinmeier, Hermann Heller, schon in der Endphase der Weimarer Republik hingewiesen. Heller warnte vor jeder »metaphysizierenden« Vorstellung der politischen Willenseinheit, auch der »demoliberalen«, betonte aber gleichzeitig, daß keine Nation ohne eine gewisse »Homogenität« bestehen könne. Diese beruhe in der Regel auf einer Menge an Selbstverständlichkeiten, die undiskutiert bleibt, weil sie durch gemeinsame Geschichte und gemeinsame Überlieferung gegeben ist. Wenn sie wegfällt, wächst naturgemäß die Versuchung, Homogenität durch Zwang oder Indoktrination neu herzustellen.
Ob beabsichtigt oder nicht: auf diesen Punkt läuft Steinmeiers Argumentation zu. Er ist genau das, was er so entschieden zu sein bestreitet: ein »Identitätskonstrukteur«, der den »Konsens« mit Hilfe »autoritärer Festlegung« erreichen will, wenn gutes Zureden ohne Wirkung bleibt. Es genügt deshalb nicht, die inneren Widersprüche seiner Vorstellungen offenzulegen oder über die fehlende Konsistenz seiner Gedankengänge und den salbungsvollen Ton dessen zu spotten, der behauptet, es sei nicht seine »Sache, Menschen etwas predigen und sie bekehren zu wollen«. Denn hier wird hinter einem pseudokonservativen Jargon nur schlecht verborgen, daß das Staatsoberhaupt von den Deutschen als angestammtem Volk und dem Vaterland nichts wissen will, sondern einen »Patriotismus« fordert, der nur ein anderes Wort für Linientreue ist, und eine »Transformation« plant, die im Zweifel mittels der »starken Institutionen« bewerkstelligt wird, nachdem die Widerstrebenden ausgeschaltet sind. ◆

KARLHEINZ WEISSMANN
geb. 1959 in Northeim, bis 2020 Studienrat für Evangelische Religion und Geschichte. Autor zahlreicher Bücher und Essays. 2022 erschien in der JF-Edition sein Lexikon politischer Symbole.
